Blog
30.10.2022 Mehr Platz für mehr Projekte
Der Keller ist voll. Das Gartenhaus ist voll. Das zweite Gartenhaus ist
auch voll. Der Dachboden ist voll (und gesperrt, versiegelt, zur Verbotenen
Zone erklärt, aber das ist eine andere Geschichte) und auch die Garage ist
voll. Ein Regal ist schnell vollgestellt und selten kann ich es komplett
nutzen, da die Grundfläche mit ein paar Gegenständen belegt ist und ich
nichts daraufstapeln kann. Ein kubisches Regal von I.ch K.rieg E.inen
A.nfall (Modell Kallax) konnte ich viel besser nutzen, als jedes Fach mit
einer kleinen, passenden Aufbewahrungsbox ausstattete: dadurch konnte ich
das volle Raumvolumen nutzen und thematische Kisten erstellen. Aber nun
musste die Garage erweitert werden: zum einen brauche ich die Möglichkeit,
schnell und flexibel etwas an die Decke schrauben zu können (Haken für
Angelschnüre, um Modelle für Trickaufnahmen aufhängen zu können oder auch um
grünen Stoff an der Decke anbringen zu können für Greenscreeneffekte), was
bisher nicht möglich war bei der bröseligen, latexfarbebeschichteten
Betondecke (hier sind stets aufwendige Bohrungen und Dübel notwendig) und
zum anderen kam mir die Idee, Aufbewahrungskisten unter der Decke
anzubringen. Diese Kisten sind idealerweise
transparent, damit ich sehen kann, was sich wo befindet und ich
muss jede Kiste einzeln abnehmen können.
Lösung:
Acht
Dachlatten (24 x 48 x4.000 mm) unter die Decke geschraubt mit
jeweils sechs 5 x 80 Universalschrauben und durchsteckbaren
Universal-Parallel-Spreizdübeln (6 mm Durchmesser, 70 mm Länge) in einem
Abstand von 39,5 cm. Dazu vier Hözklötzchen
40 x 60 x 23 mm aus Rauspundbrettern herausgesägt und mit einer Schraube
nicht ganz fest angeschraubt, damit die Klötzchen sich zum Freigeben der
Kiste drehen lassen. Fertig.
Auf einer Bahnlänge
von 4 Metern haben 7 Kunststoffkisten hängend Platz: 7 x 80 l = 560 Liter
Stauraum. Bei voll ausgenutzen 7 Bahnen sind das maximal 3.920 Liter
zusätzlicher Stauraum. Bäm.
Wenn die Kisten zu schwer sind, kann
ich einfach sechs statt vier Halteklötzchen nutzen. Ach ja, und oberhalb des
abgehängten Garagentorantriebs passen keine 80 l Kisten, sonder nur 60 l
Kisten.
Fazit: Sehr gute Lösung. :-)
28.10.2022 "Tag des Flüchtlings" oder "Tag derer, die in Sicherheit leben wollen."
Hier ein weiter Beweis über die Macht der Sprache (Morgenandacht
vom 30.09.2022 im Deutschlandfunk von Jula Well):
#offengeht: Die interkulturelle Woche feiert die Vielfalt unserer Gesellschaft – schon seit 1975 und auf Initiative der Evangelischen, der Katholischen und der Griechisch-Orthodoxen Kirche. Wer mitmacht, setzt sich ein für Menschenrechte, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie und stellt sich gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Heute, am »Tag des Flüchtlings«, geht es um die Situation von Menschen, die ihr Heimatland verlassen und sich in Sicherheit bringen müssen.
Das ist ein wichtiger Tag, doch stoße ich mich an seinem Titel. Den Begriff »Flüchtling« finde ich immer sehr problematisch.
Zugegeben, juristisch erfüllt der Begriff »Flüchtling« einen existenziellen Zweck. Die Genfer Flüchtlingskonvention regelt verbindlich, wer als Flüchtling gilt. Der Flüchtlingsstatus ist ein Ergebnis des humanitären Diskurses des 20. Jahrhunderts und hat bis heute zum Schutz von weit über 50 Millionen Menschen beigetragen hat. Die Zuordnung zur Kategorie Flüchtling rettet Leben.
Der Begriff »Flüchtling« erzeugt aber auch bestimmte Bilder in den Köpfen der Menschen. Schon die kleine Wortendung -ling spielt dabei eine große Rolle. In der deutschen Sprache bezeichnet die Endung -ling Kleines oder Junges, beispielsweise den Däumling oder Zögling. Oder sie wertet ab, wie mit den Bezeichnungen Emporkömmling oder Wüstling. Oft hat die Endung ‑ling eine passive Komponente, wie beim Schützling.
Auch beim Begriff Flüchtling sorgt sie für einen abschätzigen Beiklang. Die Wucht des Begriffs Flucht wird durch die Endsilbe geschmälert und der Begriff »Flüchtling« tendiert dazu, die Notlage und die Betroffenen zu verniedlichen und herabzuwürdigen. Vor dem inneren Auge entsteht das Bild einer deformierten Kreatur: missgestaltet, kriechend, hilflos. Das Substantiv Flucht ist ebenfalls problematisch. Es ist negativ besetzt. »Nach unserem […] Sprachempfinden ist Flucht immer ein Zeichen von […] Feigheit. Der Tapfere flieht nicht, der Tapfere hält aus.« Der Bezeichnung »Flüchtling« liegt damit auch das Bild des Feiglings inne.
Nicht in dieses Bild passen Menschen, die in einem gehobenen Mittelklassewagen ihr Land verlassen und mit dem neuesten Handy telefonieren. Die ihre Kinder per Zoom am Unterricht im Herkunftsland teilnehmen lassen und selbstbestimmt und aktiv zu Behörden gehen, um Hilfe zu beantragen, oder nach Hause reisen, weil sie Ehemänner, Mutter, Vater, Großeltern oder Geschwister seit Monaten nicht mehr umarmt haben. Darin hat Friedrich Merz ein Problem gesehen – anders als die Bundesagentur für Arbeit, die für Sozialleistungen zuständige Behörde. Und Merz hat das, was die nach Sicherheit Suchenden tun, Sozialtourismus genannt.
Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt es in der Bibel. Du sollst Gott nicht in deine menschlichen Fantasien einpferchen, sollst Gott nicht festlegen. Dieses Gebot halte ich auch in Bezug auf Menschen für wichtig: Du sollst dir kein Bildnis machen, das Menschen darauf festlegt, deformiert und passiv zu sein. Du sollst dir kein Bildnis machen, das anderen Lebendigkeit und Autonomie abspricht. Und: Du sollst anderen kein Bild zeichnen, das Menschen in Not pauschal Schlechtes unterstellt – schon gar nicht ohne ordentlichen Nachweis und gewiss nicht mit dem Unwort des Jahres 2013.
Unsere Sprache spielt eine wichtige Rolle. Sprache ist mächtig. Sprache produziert innere Bilder. Sie vermag zu inkludieren und zu exkludieren. Sie kann achten und missachten.
Den »Tag des Flüchtlings« würde ich deshalb anders bezeichnen: Heute ist der Tag derer, die in Sicherheit leben wollen. Die Unterscheidung zwischen »denen« und »uns« fällt damit weg und vor dem inneren Auge entsteht das Bild von Menschen, die aufrechten Ganges einer besseren Zukunft entgegengehen. #offengeht. Danke an alle, die uns das zeigen!
13.08.2022 Transport Security Officer Nazi Uniform
Dieses "Kostüm" sollte nicht auf öffentlichen Auftritten zu sehen sein,
da es zu stark an Naziuniformen erinnnert. Ich vermute gar begründet, dass es
bevorzugt von Mitgliedern getragen wird, die hier eine Möglichkeit sehen,
unsanktioniert und mit fadenscheiniger Begründung ihre politischen Präferenzen zur Schau zu stellen. Ich lehne
Veranstaltungen und Fotos zusammen mit diesem Transport Security Officer
(das Kostüm war im schwachen Film Solo - A Star Wars Story, 2018, zu sehen)
ab.

12.08.2022 Einsatz in vier Wänden: Trooping/ Auftritte hot oder flop?
Das Kostüm ist extrem teuer, außerordentlich empfindlich und bedarf
regelmäßiger Wartung (Nähte, Reinigung, Details, Elektronik, Elektrik). Es
handelt sich um einen Charakter, der im Weltall auftritt und daher ist ein
glänzendes, steriles, kühles und künstlich beleuchtetes Ambiente notwendig.
Auch der Tranport sowie das Anziehen & Ausziehen ist mit Aufwand verbunden.
Das Tragen des Kostüms ist selbst unter günstigen Bedingungen (kühl,
schattig, eben) eine körperliche Belastung, da es enorm warm und schwer ist.
Zudem ist die Sehfähigkeit eingeschränkt und somit werden Treppen und
Unebenheiten im Boden wie z.B. eine Kante eines Gullideckels zu einer
Stolpergefahr, die im Kostüm üble Folgen haben kann.
Daher sind
Veranstaltungen, Einsatzorte und Zweck des Einsatzes wichtige Faktoren.
Was gut geht sind Veranstaltungen mit dezidierten Fans von Science Fiction,
Krieg der Sterne, Star Wars. Als Orte sind geeignet Hallen, Freizeitparks,
Hotels, geschlossene Gebäude. Ein großes Publikum ist klasse, da hier eine
Abfolge von neuen Kontakten möglich ist. Wenn es sich nur um ein Publikum
handelt, das nur aus wenigen Personen besteht, nutzt sich die anfängliche
Faszination schnell nach wenigen Minuten ab und die Zeit wird lang. Daher
ist bei Besuchen auf Hochzeiten, Geburtstagen, Krankenhäusern,
Pflegeeinrichtungen und Hospizen eine straffe Planung notwendig, um den Spaß
hochzuhalten in einer kurzen Zeit von zehn Minuten.
Was ich ablehne, sind
themenfremde Orte, die überwiegend von Menschen besucht werden, die
keinerlei Begeisterung für das Sujet erwarten lassen: Promotion im
Supermarkt oder Kaufhaus, Auftritte bei Stadtfesten, Gartenanlagenparks,
Zoos und Tierparks. Zudem sind Außenauftritte auf unbefestigten Wegen wegen
des Staubs und Schmutzes katastrophal für den Wollmantel, die Wollrobe, die
Stiefel, die mit Autolack lackierten Hochglanzteile wie Helm und Panzerung
und einfach alles am Kostüm. Fotoaufnahmen in Tech-(Noir)-Gebäuden sind top,
Aufnahmen im Wald, am Strand, im Garten, auf dem Rasen und anderen
Naturstandorten lehne ich ab. Es ist ja schließlich Darth Vader und nicht
ein Hobbit. Im Sommer draußen und im Sonnenlicht ist die Temperatur im
Kostüm auch zu hoch, auch kommen nur Einsätze in Frage, die einen besonderen
Hintergrund haben.
11.08.2022 Warum Wasserbetten eine Lüge sind und eine Gesundheitsgefahr darstellen
Wasserbetten sind toll: keine durchgelegenen Matratzen
mehr, die alle paar Jahre ausgetauscht werden müssen, weil der Schaumstoff
oder die Taschenfedern abgenutzt sind. Kein Staub und keine Milben,
die sich im weichen Material verstecken können. Schön warm
durch extra strahlungsarme Heizung und gut für den Rücken,
da sich die Wasserbettmatratze flexibel an den Körper anschmiegt. Die
Plastikhülle, in die das Wasser gefüllt wird (mehr ist so ein Wasserbett ja
nicht), enthält keine Phthalate und keine
Weichmacher und alles ist total bio, ergo und grün. Wunderbar.
Aber leider belog mich mein Wasserbettenhändler. Ich kaufte ein kackteures
Riesenwasserbett auf Maß mit allen Extras für ein paar Tausend Euro (auf
persönliche Empfehlung eines Bekannten). Es wurde sehr servicestark sogar
aufgestellt und befüllt bei mir zu Hause von dem Händler. Dann gab es noch
die Instruktionen: alle paar Monate Wasser auffüllen und "Conditioner"
einfüllen. Dazu mit "Pflegetüchern" die Wasserbetten-Folie
von "scheuerndem Staub, Hautschuppen und Schweiß reinigen"
und "Pflegecreme" großzügig auftragen. Das habe ich ein
paar mal gemacht aber diese großflächige Wischerei und Eincremerei nervte
mich dann doch und ich kaufte noch einen zusätzlichen "Top-Liner",
der als Staubschutz fungieren sollte. Dadurch kommen kein
Staub, Körpersalz oder Hautschuppen mehr auf die Vinylfolie/ den
Wasserbeutel und ich spare mir die Putzerei.
Nach ein paar Monaten
brauchte ich mehr von dem "Conditioner" und kaufte diesen arglos wie gewohnt
beim mich belügenden Wasserbettenverkäufer. Der mich belügende Verkäufer
notierte wie immer meinen Namen und das Kaufdatum um "die Garantie
sicherzustellen". Diesmal kaufte ich aber wie gesagt ja nur den
"Conditioner" und nicht wie sonst die "Pflegetücher" und "Pflegecreme". Der
mich belügende Verkäufer fragte mich dann überraschenderweise sehr
penetrant, wieso ich nur Conditioner kaufe und forderte mich auf, auch
Tücher und Creme zu kaufen. Als ich erklärte, dass ich die Tücher und Creme
nicht mehr so oft benötige, da ich bei ihm ja den kackteuren Top-Liner
gekauft und angebracht habe, der Staub etc. verhindert, bestand
der mich belügende Verkäufer dennoch darauf, dass ich
Tücher und Creme kaufen und anwenden müsse, da "sonst die
5-Jahres Garantie auf Dichtigkeit des Wasserbetts nicht
aufrechterhalten werden kann". Das ergab für mich so gar keinen
Sinn.
Eine schnelle Recherche und Rücksprache mit dem Hersteller
der Tücher und der Creme lieferte mir jedoch schnell die Erklärung: sowohl "Pflegetücher"
als auch die so putzig frisch nach Zitrone duftende "Pflegecreme"
sind randvoll und hochkonzentriert ausschließlich aus Weichmachern.
Ich trage also unwissend pfundweise pure Weichmacher auf
die Vinylfolie auf, damit das Plastik länger geschmeidig bleibt und nicht
spröde wird. Dadurch hält das Plastik länger und der mich belügende
Verkäufer kann seine Kackgarantie sicherstellen, dass der Wassersack nicht
vorzeitig undicht wird. Weichmacher verursachen Krebs, Fehlbildungen
und sind erbgutschädigend. Dieses Zeugs durchdringt auch
Schutzhandschuhe mit Leichtigkeit.Toll.
Bonus-Mist:
Ich
wollte den Standort des Wasserbetts verändern und habe das
selbst vorgenommen. Dazu habe ich mir vom mich belügenden Händler eine Pumpe
geliehen und Conditioner gekauft. Der mich belügende Händler hat mich zwar
bedrängt, dass er das machen müsse wegen Qualität und Erfahrung und anderem
Quatsch, aber ich hatte keine Zeit für einen Termin und sah auch keine
Notwendigkeit, dafür erneut Handwerker ins Haus kommen lassen zu müssen.
Also Wasser abpumpen, Gestelle verschieben, Wasser
rein, Conditioner rein und fertig, Pumpe zum
Händler zurück und gut ist. Aber halt, was ist das? Nach einigen Wochen fing
es an, beim Bett zu stinken. Das Wasser
war gammelig geworden. Also dringt durch die
Folie nicht nur Wasserdampf (ich muss das durch die Folie
verdunstende Wasser ja regelmäßig auffüllen) sondern auch der Gestank/ die
Gestankmoleküle. Somit steht fest, dass durch die Folie
auch die Stoffe, die im Wasser sind,
hindurchdiffundieren. Als ich meinen mich belügenden Händler auf
das Stinkewasser ansprach, gab er an, dass man ja auch einen für mich bis
dahin unbekannten sogenannten "First Filler" beim ersten
Befüllen des Wasserbetts einfüllen müsste. Danach würde auch beim Nachfüllen
ein Conditioner reichen, aber die Wirkung des Conditioners allein sei nicht
ausreichend. Nachdem ich dann ja später auf die Weichmacher-Lüge
gestoßen war, habe ich dann mir mal angesehen, was im "First
Filler" und "Conditioner" enthalten ist an
Giftstoffen, die ich ja jede Nacht einatme und geradezu inhaliere
(wenn diese Chemikalien schön erwärmt zusammen mit dem Wasserdampf durch die
Vinylfolie entweichen): jede Menge gewässerschädliche, giftige,
organismentötende Verbindungen und sogar Brom (das ja auch
als Hängolin bekannt
ist).
TLTR:
die "Pflegemittel" enthalten puren, giften
Weichmacher. Der Verkäufer drängt auf Benutzung der Pflegemittel, da somit
die Garantie leichter eingehalten werden kann.
Die Wasserzugaben
"Conditioner" und "First Filler" enthalten extreme Gifte, die durch die
Vinylfolie austreten und eingeamtet werden.
10.08.2022 R-Type Delta (PSX/ Playstation 1) per Retroarch crashes
Ja, dieses Spiel sieht zunächst sehr grobschlächtig und unnötig auf
3D-getrimmt aus. Tatsächlich ist es eine ganz hervorragende R-Type-Variante
mit vielen liebevollen Effekten wie Unterwasser-Lichtreflektionen,
Luftblasen und Bussen, die von Schlangen-Horizontalbohrer-Robotern
in die Richtung des Spielers durch den Raum geworfen werden. Alles
interagiert: die Wasseroberflächen spritzen bei Beschuss oder Durchfliegen,
die Raketen haben eigene Flugmuster, Bienenkörbe hinterlassen rote Flecken
und sogar die Leitwerke des Sattelits fächern sich auf oder ziehen sich
zusammen bei rückwärts oder vorwärts gerichteter Bewegung des eigenen
Raumschiffs. Unglaublich. Das gleiche Maß an Sorgfalt wurde angelegt für
Gameplay, Leveldesign und Pacing. Dieses Spiel ist so gut, dass ich erwägte,
extra eine alte Playstation 1 und eben R-Type Delta zu
kaufen, da leider das Spiel jedesmal auf meiner SNES mini Classic auf Basis
von Hakchi und Retroarch crasht/ abstürzt/ resettet nach
dem Besiegen des Endgegners von Level 2 (eine Seegurke mit
einem Horroroktopus). Ich probierte alle Tricks wie Abschalten des
Röhrenraster-Overlays, andere Cores der PSX (PCSX1, ReARMed, UNAI, PEOPS,
NEON, Xtreme, Amped, FS in allen Variationen) oder andere Installationen
(Europe, US etc.) aber nach Ende von Level 2 war stets: crash, blackscreen,
reset. Ein Löschen des PSX-BIOS-Dateien (scph5500.bin, scph5501.bin und
scph5502.bin) habe ich erwogen, aber verworfen, da die ja die Emulation
perfekt beschleunigen und auch funktionieren.
Die Lösung:
select + start drücken, einen State-Slot wählen und save state ausführen.
Dann einen load state vornehmen und ab sofort läuft das
Spiel wie eine Eins.
09.07.2022 beste Beschreibung der Bild-Zeitung aller Zeiten
Der Philosoph Günther Anders beschreibt schon 1956 in
seinem Hauptwerk "Die
Antiquiertheit des Menschen":
"Das Hauptverhängnis unseres
heutigen Daseins heißt: Bild. Verhängnis deshalb,
weil heute Bilder nicht mehr als Ausnahmen vorkommen, weil wir von Bildern
vielmehr umstellt, weil wir einem Dauerregen von Bildern ausgesetzt sind."
Anders attestiert der Menschheit eine unheilbare Ikonomanie, eine
Bildgefräßigkeit, die Hirn und Augen verkleistert und auf
Dauer ein post-literarisches Analphabetentum züchtet. Die
Ursache der schleichenden aber unausweichlichen Verdummung
liegt in der Punktualität, im Inselhaften der Bildinformation. Bilder, so
argumentiert Anders, machen im Unterschied zu Texten keine
Zusammenhänge sichtbar. Sie verkürzen das Verstehen auf bloßes
Sehen, zeigen lediglich Weltfetzen, isolierte Momente, die in ihrer
unmittelbaren visuellen Wirksamkeit stecken bleiben. Am Ende erzeugt die
Ikonomanie ein passives Voyeurtum, das uns nur
vorgaukelt, informiert zu sein. Über kurz oder lang führt das
inflationäre Abbilden der vermeintlichen Wirklichkeit zur Entwirklichung der
Welt: Wir ersetzen unsere eigene Wahrnehmung durch visuelle Surrogate. Erst
überlagern die Bilder die wahrgenommene Welt, dann lösen sie die
Wirklichkeit auf in Reihen zusammenhangloser Momentaufnahmen,
die kein Ganzes mehr ergeben. Am Ende der apokalyptischen Vision verwandelt
sich der Mensch in jene Bilder, die er von sich und seiner Welt entworfen
hat.
Günther Anders besorgter Blick auf die Invasion der Bilder ist
erstaunlich hellsichtig, ihr ungebremstes Wuchern und digital
gedüngtes Aufschießen konnte er aber nicht stoppen. Unser
Bildverbrauch explodiert, knackt Jahr um Jahr neue Rekordmarken und ersetzt
vielfach schon probate Kulturtechniken wie das Lesen.
Quelle:
Homo pictor - Der Mensch und die Bilder, von Simon Demmelhuber.
hier
das ganze Script.
03.07.2022 Donkey Kong Arcade (1981) Tipps & Tricks
Ich habe eine SNES Mini Classic mit allerlei Arcade- und
Konsolenklassikern aufgeübscht (Arcadeoriginale, Atari VCS 2600, C-64,
Playstation 1, NES, SNES, Sega Master System, Sega Mega Drive, Dreamcast, PC
Engine, NeoGeo, um in den Pausen auf der Arbeit den jungen Kollegen beim
Highscore-Wettkampf mal zu zeigen, was damals für eine harte Gangart üblich
war auf den Systemen. Ich habe natürlich alle Highscores inne und
in der Kreidetafel-Hall-of-Fame prangen nur meine Initialien
(Raiden [die noch härter Version der PC-Engine], Chelnov, Hang-On, Mario
Bros., Moon Patrol, R-Type, Root Beer Tapper [ok, hier wurden zur Ausnahme
einmal die N.H.-Initialien geduldet], Donkey Kong und Galaga 88). Während
meines Urlaubs erdreisteten sich zwei Newcomer einfach, ein neue Spiel auf
einer Blanko-Highscore-Tafel zu hieven und sich qua meiner Abwesenheit
sogleich auch mit den eigenen Initialien zu manifestieren (die Formulierung
'verwigen' ist hier nicht angebracht, solange ich mitspiele): Pac Man. Ok,
folks, challenge accepted. 12 K wurden zu 18 K, ein weiterer Kollege schob
den Score dann auf 22 K und ich sah mich genötigt, Tutorials und
Fachliteratur zu studieren um schließlich nach drei Wichen mit 152 K alle
Mitstreiter zu demütigen und die Moral zu atomisieren. Der sehr
junge,ehrgeizzerfressenee 22 K Pac Man Kollege jedoch nahm den
Fehdehandschuh auf und übertrug den Krieg auf ein neues, vom ihm gewähltes
Schlachtfeld: Donkey Kong. 18 K, 40 K, 50 K und die Platz auf der Tafel war
fast täglich neu zu beschriften. Schließlich knallte er mit 100 K und Level
4 ersteinmal einen Wert ins Kontor, an dem ich wochenlang zu knabbern hatte.
Mehr als 92 K gelangen mir einfach nicht. Er legte nach auf 111 K und gab
an, mittels hartem Point-Pressing (alle Punkte, Extras und Hüpfpunkte
mitnehmen und strategisch innerhalb der 4 Levels sterben) das erreicht zu
haben ganz ohne jedes Tutorial. Na toll. Ich hatte wie besessen geübt und
alle Tutorials angesehen, die ich finden konnte. Nun endlich ist es mir
heute gelungen, den 4. Screen des 5 Levels zu erreichen und 118 K zu
erreichen. Es war ein sehr harter Weg. Donkey Kong ist viel komplexer,
fummelieger, frustrierender und nerviger, als ich es mir vorstellen konnte.
Hier mein hart erarbeitetes Wissen über die orignale, japanische Version (4
Screens bilden einen Level: Fässer-, Förderbänder-, Aufzüge-,
Bolzen-Screen):
1.) wenn Jumpman (Super Mario) auf einer Leiter im
Fässer-Screen steht und mit einer Hand das rote Gitter berührt,
fallen keinerlei rollende Fässer die Leiter herunter und
Mario ist dort sicher. Aber die gerade nach unten fallenden Fässer, die
zick-zack-nach unten fliegenden Fässer und die Flammen können nach wie vor
Mario erwischen. Dieser Tipp gilt wohl nur für die amerikanischen Version,
die ich spiele: die Screenabfolge ist immer gleich, zumindest bis Level 5.
Es gibt aber wohl unanhängig von der Länderversion eine schwierige Version,
bei der die Fässer auch die Leitern herunterfallen, wenn Mario/ Jumpman das
rote Gitter mit der Hand berührt. Gott bewahre, dass ich das auch noch
lernen müsste... das wäre ja nochmal schwieriger zu bewältigen.)
2.) Mario kann über die Flamme springen
(das vermeide ich jedoch, da unsicher ist, wohin sich die Flamme bewegt).
3.) Wenn Mario sich den Fässern entgegenbewegt, fallen
diese viel häufiger die Treppe herunter.
4.) die
Flammen im Förderbänder-Screen erscheinen auf der
Seite, auf der sich Mario gerade befindet.
Das Aufzüge-Screen ist spätestens ab Level 4
die Hölle, da die Sprungfedern superviele Schwierigkeiten machen:
in Level 1 kann man an der dritten Spitze des roten Gitters
warten, bis eine Feder über Mario fliegt und dann einfach die Treppe
heraufflitzen, um diesen Screen zu schaffen.
In Level 2
warten man an der dritten Spitze und läuft, sobald eine Feder über Mario
ist, nach links bis zur gelben Aufzugsplatte. Eine Spitze nach rechts kann
man sich hinstellen und mit der nächsten Feder die Leiter hochflitzen.
In Level 3 muss man eine Feder abwarten, die zwischen den
Beinen von Donkey Kong landet ("lange Feder" im Sinne einer
Feder, die einen langen Weg zurücklegt und somit mehr Zeit vergeht, bis die
nächste Feder kommt), um von der dritten Spitze aus wartend auf die gelbe
Aufzugsplattform zu laufen. Eine Spitze rechts daneben ist der Startpunkt,
um bei der nächsten langen Feder die Leiter hochzuflitzen.
Level 4 ist dann richtig fordernd
(danach wird es nicht mehr wesentlich schwerer, hoffe ich):
Auf
der dritten Spitze auf eine kurze Feder warten (also eine
Feder, die beim linken Fuß von Donkey Kong (also Donkey Kongs rechter Fuß)
landet), dann eine Spitze nach links gehen und sobald die
kurze Feder über Mario ist, auf die gelbe Auszugsplattform
laufen. Eine Spitze rechts davon ist wie immer der Startpunkt, um dann bei
der nächsten langen Feder die Leiter hochzulaufen.
Aber Achtung: wenn auf die lange Feder direkt eine weitere
lange Feder folgt, erwischt sie Mario auf der
Leiter und ein Leben ist weg. Also muss man entweder viel
Glück haben oder kurz vor der Leiter schauen, ob eine kurze oder lange Feder
folgt und entsprechend hoch- oder zurücklaufen. Das ist wirklich nicht soooo
leicht und bisher schaffe ich es gerade irgendwie, Level 5 zu erreichen mit
viel Glück: diese lange Feder-Prüfung und Abbruchroutine
habe ich noch nicht drauf. Aber egal, Hauptsache, ich habe den Highscore.
Bäm! :-)
03.05.2022 Characterlenses blogspot
https://characterlenses.blogspot.com/2021/09/review-of-1950s-helios-40-85mm-f15-40.html
Review of the 1950's Helios-40 85mm F1.5 (Гелиос-40)
Hier eine schöne Bestätigung, dass es sich bei dem Riesentrumm eines Objektivs tatsächlich um eine sehr einzigartige Kombination aus Fehlern und Charakter handelt.
24.04.2022 Canon EOS 100D white mit dem Bokeh Monster Helios 40 85mm f/1.5




20.04.2022 Helios 40 f/1,5 85 mm Red P





17.04.2022 Helios 40 85 mm 1,5 Silver - You've Come A Long Way Baby
Ich habe mir zum Geburtstag ein mich sehr ansprechendes Objektiv gegönnt: ein altes, wahrscheinlich aus dem Jahr 1957 stammendes Helios 40 Objektiv, das aussieht, wie aus der Weltraumforschung mit all dem glänzenden Metall. Es war brutalst teuer, aber dafür soll es ein adäquater Nachbau des Carl Zeiss Jena Biotar 75mm f/1.5 sein und ein einzigartiges Wirbelbokeh in den Hintergrund zaubern. Es scheint wirklich für den Weltraumaußeneinsatz gebaut worden zu sein, denn es ist sehr massiv und schwer mit über einem Kilogramm Gewicht (und damit satt doppelt so schwer wie das Carl Zeiss Biotar). Aus Russland bekommt man es aktuell gar nicht wegen des bekackten Kriegs und der Zustand der Objektive ist häufig sehr zweifelhaft. Moldau und Ukraini scheiden auch nahezu aus als Quelle aktuell. Dazu kommen Versand, massig Zoll und Abwicklungskosten. Ganz wichtig hier bei meinem Fang: eine sehr frühe Serienummer (002267) und eine rote Markierung in Form eines П (der russische Buchstabe, der unserem 'P' entspricht). Die rote Buchstabenmarkierung wurde entsprechend der Carl Zeiss Jena Biotar 75 mm Vorlage übernommen, die den Buchstaben 'T' trug, um auf die bessere Beschichtung der Gläser hinzuweisen in Form der Transmissionsschicht, die durch gegenphasige Amplitudenveschiebung eine Interferenz erzeugt und somit trotz doppelter Reflexion tatsächlich die Reflexionen stark reduziert.) Also her mit dem vermeintlich überteuerten Ebayangebot des "Profihändlers" Foto Fina. Was wurde da nicht alles zugesichert: "
Gegenlichtblende Lifehack für das alte Helios 40 85 mm 1,5 mit 66 mm Duchmesser
Das Objektiv hat ein sehr exotisches Filtergewinde: 66 mm Durchmesser mit 0,75 mm Steigung- das ist ein Problem, da die Linsen in der Konstellation und Beschichtung bei Gegenlicht zu extremsten Blendenflecken neigen. Eine Gegenlichtblende ist also sowohl Innen als auch Außen absolut notwendig. Aber es gibt keine. Eine Streulichtblende/ Lens Hood mit 67 mm Durchmesser könnte ich am Gewinde etwas abschleifen und reinwürgen oder vielleicht eine flexible aus Gummi oder selbstgebaute aus Pappe benutzen aber alle diese Lösungen sehen nicht angemessen aus an diesem eleganten Traum aus silber glänzendem Metall. Ich bekam jedoch in der Helios 40 Facebookgruppe den tollen Tipp, dass ich einfach die eigentlich heutzutage nutzlosen drei Farbfilterlinsen dafür nutzen kann: einfach die innenliegenden Gewinderinge herausschrauben, die Gläser entnehmen und dann die drei Filterhalter flugs aufeinanderschrauben und vorne am Objektiv anbringen. Perfekt. Das sieht sehr gut aus, sitzt fest, funktioniert wie gewünscht und ist sogar in der Länge variabel.
16.04.2022 Emio The Edge Super Joystick für SNES mini Classic und NES mini
Dieser Joystick hat nun alle Knöpfe des SNES-Pads ordentlich aufgereiht und statt einer Turbotaste, die mittels Drehreglers in der Frequenz verändert werden kann, ist tatsächlich für jeden der sechs Knöpfe eine separate Turbo-Taste vorhanden, die einzeln jeder Taste die Dauerfeuerfunktion verleiht. Ich bin etwas irritiert, dass hier keine Frequenzanpassung möglich ist, aber es ist ohnehin für mich ohne Belang, da ich die Actiontitel, die regelmäßig von Dauerfeuer profitieren, auf der für Shooter ja unegeeigneten, weil technisch arg schwachbrüstigen SNES gar nicht mag (ich bevorzuge die Spielhallenoriginale oder die PC-Engine oder die Neo-Geo). Dennoch habe ich mir diesen Riesenjoystick aus den USA schicken lassen, da ich einen Joystick in der Vierwege-Vorzugskonfiguration vorhalten wollte (den The Edge Emio NES Joystick, der einem Nintendo NES Advantage von Asciiware 1987 gleicht) und einen weiteren mit klassischer Achtwegekonfiguration. Also habe ich dann diesen Riesenjoystick bestellt, zumal dieser ja eben auch alle sechs Knöpfe der SNES und nicht nur die beiden der NES beinhaltet. Große Überraschung: der Emio Super Joystick, Modell IUI001146, ist sehr viel besser als der NES Advantage: die Mikroschalter haben jetzt alle einen Hebel installiert, so dass die Auslösung noch präziser von statten geht. Zudem ist der Joystick härter zentriert: der weichere NES mini Joystick zeigt Fehlfunktionen/ Fehlsteuerungen, weil der Joystick, wenn ich ihn mit Schwung loslasse, in die entgegengesetzte Richtung zurückfedert und den entsprechend entgegengesetzten Mikroschalter auslöst. Dieses Verhalten ist für Pac Man fatal. Zwar kann ich, wenn ich um dieses Problem weiß, darauf Rücksicht nehmen, aber es ist dennoch viel komfortabler mit dem SNES Super Joystick von Emio zu spielen, da dieser diese Falschsteuerungen nicht zeigt, selbst wenn ich ím Eifer des Gefechts den Joystick einmal losschnellen lasse. Die Ablagefläche für die recht Hand ist riesig und sehr bequem. Volle Empfehlung also für diesen deutlich besseren Joystick, der übrigens auch ohne den peinlichen Pin-Out-Korrektur-Adapter auskommt, mit dem der NES Joystick noch notdürftig geflickt werden musste. Nächster Schritt ist dann der nahezu orignale Spielhallen Joystick, der vier Mikroschalter mit Hebeln (das Arcadeoriginal arbeitet mit lautlosen und sehr schnell auslösenden Blattkontaktschaltern [leaf switch], aber für Pac Man ist die hohe Auslösefrequenz weniger wichtig als für Sportspiele. Puristen benmägeln jedoch die Geräusche) besitzt, die so angeordnet sind, dass nur vier Wege möglich sind und niemals acht Wege. Dazu ist der Hebel sehr kurz, die Hebelwege bis zur Auslösung sind viel kürzer als bei den NES und SNES Joysticks und die Zentrierung ist sehr fest. Davon verspreche ich mir noch präzisere und vor allem schnellere Eingaben für noch höhere Pac Man Rekorde. Ich werde einen weiteren SNES The Edge Emio Joystick als Basis für den Umbau des Spielhallenjoystick nutzen.
27.03.2023 Pac Man und Donkey Kong brauchen nur vier Wege statt acht
Warum spielt sich Pac Man so unsagbar hakelig, frustrierend und nervig
mit einem Joypad oder mit einem klassichen Joystick? Ständig bleibt das
gelbe Viech hängen, verpasst Abzweigungen nach oben und unten oder wechselt
in eine nicht gewünschte Richtung. Am Automaten hingegen flitzt der Puck Man
geschmeidig wiie gewünscht durchs Labyrinth ohne zu zicken oder zu haken.
(Ich sage ja nicht, dass es unmöglich ist, mit einem Joypad oder Joystick
Pac Man zu meistern, aber es fordert sehr viel mehr unnötige Konzentration
auf die Steuerung als auf das Spielgeschehen und nervt daher ungemein.).
Zunächst dachte ich nach der verkrampften Herumbrecherei mit dem Joypad,
dass ein klassischer Joystick Abhilfe schaffen würde, da so ein Hebel viel
mehr Weg zum Steuern erfordert und somit sicher leichter und vor allem
präziser das Manövrieren ermöglichen würde. Aber weite gefehlt: Auch der
Joystick "The Edge Joystick" Item No. 00136 von Emio extra für das NES
Classic Mini oder SNES Classic Mini bietet für Pac Man Frusthakelei deluxe:
Pac Man steuert sich nur bockig und nicht wie gewünscht. (Es liegt ein
scheinbar sinnfreier Adapter bei: der Stecker des The Edge Joystick für das
NES Classic Mini wird in den Adapter gesteckt, auf dem "Classic Edition
Adapter" steht, und dann in die NES Classic Mini gesteckt. Das ist
notwendig, da ohne den Adapter, also wenn man den Stecker des Teh Edge
Joysticks direkt in die NES oder SNES Mini Classic Buchse steckt, es immer
wieder zu falschen Signalen/ zu langen Signalen kommt, wie ich entsetzt beim
Probespielen von Galaga 88 feststellen musste. Mit Adapter ist jedoch alles
perfekt.).
Wie kommt nun dieses bockige Verhalten von Pac Man zustande?
Der Pac Man Arcade Spielhallenautomat hat statt eines 8 Wegejoysticks "nur"
einen 4 Wege Jostick. Das erscheint logisch, da Pac Man ja auch nur diese
vier Richtungen benötigt zum Spielen (so wqie Donkey Kong). Aber Achtung,
hier lauert ein Missverständnis: ein 4 Wege Joystick bedeutet nur, dass die
vier Hauptrichtungen leichter angesteuert werden können, dei anderen 4
Richtungen sind nach wie vor möglich (aber etwas weniger leicht). Bei einem
8 Wege Joystick sind alle 8 Richtungen gleich leicht erreichbar. Was bdeutet
das nun genau? Die Programmierung von Pac Man berücksichtigt immer nur das
letzte Steuersignal, wobei wichtig ist, dass ein Signal ein Impuls ist, der
vom Betätigen des Richtungsschalters einmalig hervorgerufen wird. Wenn ich
nun nach rechts steuere, gibt es ein Signal für die Steuerung von Pac Man
nach rechts. Soweit, so gut. Nun rutsche ich aber ein wenig mit dem Joypdad
oder 8 Wegejoystick nach oben und löse den Schalter/ Kontakt nach oben aus,
während ich aber immer noch nach rechts gedrückt halte. Dieser Zustand
(rechts und oben gleichzeitig gedrückt) wird eigentlich von Spielen mit 8
Wegen als Richtung nach rechts oben oder eben diagonal rechts oben
interpretiert. Pac Man kenn aber keine diagonalen Bewegungen. Daher schnappt
sich Pac Man nur das letzte Signal und das lautet "nach oben". Wenn ich das
nun als Spieler sehe und aber nach wie vor nach rechts will, korrigiere ich
die Richtung und bewege den Joystick/ das Steuerkreuz wieder etwas weiter
nach rechts und weniger nach oben. Das Problem: wenn ich dabei ohne Pause
nach rechts gehalten habe, wird bei der Korrektur kein neues Signal erzeugt,
da der Kontakt nach rechts ja die ganze Zeit schon gehalten wurde. Resultat:
Trotz der Korrektur flitzt der gelbe Freak weiter nach oben, weil das ja der
letzte Impuls war, den das Programm erhalten hatte. Ein Katastrophe, die den
Spielspaß vernichtet.
Nun könne man einfach das Signal zerhacken und mit
1 Khz Frequenz wiederholen, dann gäbe es ständig neue Impulse, die
Korrekturen ermöglichen würden, Dazu müsste aber die Joystickhardware
geändert werden (z. B. mit einem
E-Limitator).
Die pragmatischere Lösung: der quadratische
Bewegungsrahmen wird um 45 Grad gekippt und jede Ecke führt nun direkt auf
eine der Hauptrichtungen zu. Dadurch wird beim verkrampften Steuern
automatisch der Weg in die Spitze geführt und somit sichergestellt, dass nur
einer der vier Kontakte geschlossen wird. Mit mehr Feingefühl und
Konzentration ist es dennoch nach wie vor möglich, eine der Diagonalen zu
erreichen (also zwei Kontakte gleichzeitig zu schließen). Ich habe die 4
Wege Konstellation mit einem 2D-Shooter (Raiden 2 DX) ausprobiert: die
Diagonalen sind spielbar, aber lästig. Der Shooter spielt sich in der 8 Wege
Konstellation natürlich besser.
Pac Man hingegen spielt sich mit der 4
Wege Einstellung fantastisch: schnell, präzise und die gewünscht rauscht die
gelbe Buffetfräse durch die Gänge und intuitiv läuft die Steuerung entspannt
und schnell ab. Ich kann mich nun ganz auf die Taktik und das Spielgeschehen
konzentrieren und muss mich nicht mehr mit verpassten Abzweigungen und
ungewollten Richtungswechseln herumschlagen. Genial.
Der Joystick muss
nur einmal geöffnet werden (zwei Schrauben auf der Unterseite sind direkt
sichtbar, die anderen vier sind unter den aufgeklebten Gummifüßen), dann
ziehe ich die beiden hochstehenden Plastikstummel etwas nach oben (zu mir
hin) und drehe die Scheibe ein wenig, so dass die Stifte in der nächsten
Kerbe landen und verriegelt sind. Das erfodert ein wenig Kraft und ist
schwergängig aber die Alternative, die das gleichzeitige Lösen der vier
schwarzen Haltenasen beinhaltet, um dann die abgelöste, transparente Scheibe
von unten zu drücken (statt die Stifte zu ziehen) und zu drehen, gelang mir
nicht, da ich an den Haltenasen scheiterte.
der superstabile Joystick von Emio für das NES Mini Classic und eben auch für das SNES Mini Classic. Steelplay trifft es ganz gut: die Mikroschalten vermitteln stählerne Robustheit.
zwei Schrauben sind sichtbar, vier weitere sind unter den Gummipads.
alles sechs Schrauben des The Edge Joystick sind entfernt.
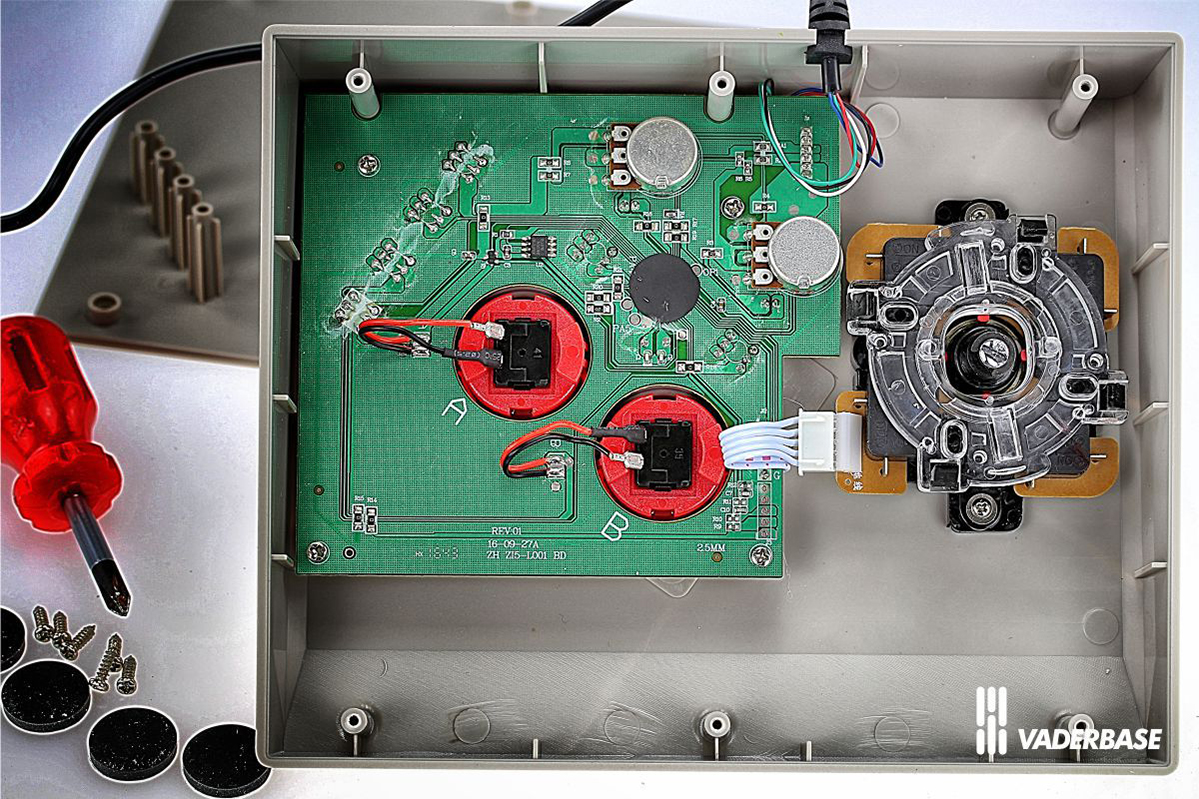
die stabilen Feuerknöpfe und die Potentiometer zur EInstellung des Autofire sind gut zu erkennen. Rechts die Mikroschalter und die 8 Wege und 4 Wege Joystickoption.
Die 8 Wege Konstellation des Joystick. Wenn ich verkrampft nach unten drücke, kann ich leicht nach links oder rechts wandern und einen zweiten Kontakt mitauslösen.
einer der beiden Haltestifte, die nach oben abstehen. Diese beiden, gegenüberliegenden Stifte ziehe ich nach oben und drehe dann mit etwas Gewalt die Scheibe um 45 Grad krachend bis der Stift in der nächsten Kerbe landet.
hier sind gut die weiteren Kerben zu sehen, in die ich die Stifte der Scheibe drehen kann.
nun ist beim beherzten Ziehen des Joystickhebels nach unten gut zu
erkennen, dass die beiden schrägen Wände der Scheibe dafür sorgen, dass
ich zuverlässig unten in der Mitte lande und nur den Kontakt nach unten
auslöse. Es ist aber dennoch möglich, nach wie vor auch einen zweiten
Kontakt gleichzeitig mitauszulösen, wenn ich konzentriert und feinfühlig
vorgehe. Aber wenn es schnell und etwas gröber zugeht, gibts präzise und
intuitiv nur vier Richtungen. Eine geniale Lösung.
23.03.2023 Wie oft durchläuft der Arduino die Programmschleife pro Sekunde
Wie oft schafft es der Arduino, die Programmschleife pro Sekunde zu
durchlaufen? Das ist wichtig, um den exakten Moment zu erwischen, in dem die
Lichtschranke unterbrochen wird und das Signal an den Eingangpin des Arduino
sendet. Anfangs waren es wohl nur etwa vier Durchgänge pro Sekunde, was zu
Schwankungen und Aussetzern der Messung führte. Jetzt habe ich ja die
Display-Erneuerung reduziert und die Geschwindigkeit erhöht. Um nun
abzuschätzen, wie viele Durchläufe pro Sekunde ablaufen, habe ich ein
Methode ohne die langsame Serial-Ausgabe benutzt:
Also statt der
langsamen seriellen Ausgabe der Millis-Zeit habe ich nun einfach nach dem
Start des Programms am Ende der Schleife eine long Variable jeweils um Eins
erhöhen lassen um dann die intergrierte Led auf PIN 13 des Arduino PCB
blinken zu lassen. Ich messe einfach grob mit der Stoppuhr die Zeit zwischen
Programmstart nach einem Reset und dem Beginn des Blinkens der kleinen,
grünen LED des Nano.
Ich musste die Variable von int (Wertbereich nur
bis 37.767) auf long (bis 214.7483.648) ändern, da die Zeit so seltam kurz
war. Ergebnis: es sind in acht Sekunden für eine Million Durchgänge und
für 10 Millionen braucht der Arduino eine Minute und 20 Sekunden. Das sind
sagenhafte 125.000 Abfragen pro Sekunde. Impressive. Most Impressive.
(Nachtrag: der AnalogRead Vorgang dauert 100 Microsekunden, also
1/10.000stel Sekunde- somit sind nicht mehr als 10.000 verschiedene Abfragen
pro Sekunde möglich. Naja, muss auch mal reichen...)
long Z = 0;
int Led = 13 ;
pinMode (Led, OUTPUT) ;
void
loop(){
Z++;
if(Z > 1000000){
digitalWrite (Led,HIGH);
delay
(500);
digitalWrite (Led,LOW);
delay(500);
}
22.03.2022 Helios 40 im Vergleich
Hier einmal der Vergleich von Bildsausschnitten. Helios 44 2 mit 58 mm Brennweite und einer Blende von 2,5, Sonnar 135 mm mit 3,5, Helios 40 mit 85 mm und 1,4, Canon FL 55 mm mit 1,2, Canon 50 mm mit 1,8, Canon 60 mm Makroobjektiv (das für mich überraschenderweise ja auch auf üblichen Distanzen funktioniert) mit einer Blende von 2,8 und schließlich eine Makroaufnahme von dem Alessi Rex mit dem gleichen Objektiv. Schärfe und Bokeh sind recht unterschiedlich aber vor allem das MC Sonnar 3,5/ 135 Carl Zeiss Jena DDR sticht für mich hervor, da es Schärfe und Hintergrund perfekt kombiniert und dabei noch sehr handlich ist (im Gegensatz zum Monstertrum Helios 40).






21.03.2022 Zoetropic Animated Picture Vinyl Record Super Mario 7" Duck Hunt
Die Vinyl-Schallplatten zum Soundtrack von "The Force Awakens" (Episode
7) bieten eine atemberaubende Animation: Drahtgittermodelle drehen sich um
die eigene Achse und scheinen dabei sogar greifbar über der Schallplatte zu
schweben, da es tatsächlich eine stereoskopische 3D-Illusion (also je eine
eigene Animation für das rechte und das linke Auge) ist. In diesem
Zusammenhang fällt mir das 3D-Display des Nintendo 3DS Xl ein, das mir nach
wie vor rätselhaft und beeindruckend erscheint. Dieses Schauspiel kann ich
ohne jede technische Ausrüstung jederzeit genießen: keine Brille, keine
spezielle Aufnahmetechnik oder Filter sind notwendig. Nur sollte die
Lichtrichtung passen: nur wenn auf Richtung der Augen das Licht auf die
Plattenrillen fällt, wird die Reflektion korrekt im Auge abgebildet (dazu
nehme ich einfach ein Kopflampe, die ich sonst zum Laufen in der
Winterdunkelheit nutze). Eine klassische Stroboskopscheibe benötigt die
richtige Flackerfrequenz der Lichtquelle (50 hz Wechselstrom lässt
Glühbirnen 100 Mal pro Sekunde an- und ausgehen): dieses Flackern ist nicht
notwendig für dei 3D-Animation der Star Wars Schallplatten. Animierte
Schallplatten sind für mich aber recht neu und interessant, also schau ich
genauer hin: Es gibt da diese Super Mario 7" Schallplatte (17,5 cm
Durchmesser) mit 8-Bit-Musik, die einen schönen Kontrast zm klassichen
Plattenspieler darstellt. Auch hier soll eine Animation erscheinen. Nun ist
die Platte angekommen und ich habe sie gleich aufgelegt. Aber leider
bin ich enttäuscht, denn ist keine Animation zu erkennen. Weder bei
Tageslicht (war klar) noch bei Beleuchtung mit einer 50 hz
Stroboskoplichtquelle. Nichts zu erkennen. Zunächst dachte ich, es könnte
daran liegen, dass die US-Bürger diese seltsame 60 hz-Frequenz für ihren
Wechselstrom nutzen (was dann ja auch zur noch seltsameren fps Zahl von 29,97
führte) aber ich da lag ich falsch. Der Stroboskopeffekt tritt nur zu Tage,
wenn man die sich drehende Platte mir einer Kamera aufnimmt und dann die
Aufnahme betrachtet. Nur dann. Oder wenn wenn man Stroboskoplicht mit einer
Frequenz von 30 hz benutzt (dieses habe ich aber gerade keine Lust zu
bauen). Denn die Kameras der Handy nehmen in aller Regel mit 30 Bildern pro
Sekunde die Videos auf. Rätsel gelöst, Enttäuschung groß. Ich mag keine
Effekte, die nur durch Zwischenschaltung von anderen Geräten sichtbar
werden. Doof.
Aber vielleicht kann ich ja mit dem 50 hz Licht
etwas anfangen und eine eigene Animation erstellen, die dann unter diesem
Licht sichtbar wird ganz ohne Kamera... mal schauen, wie weit ich komme mit
diy Phenakistiscope. Wenngleich ich vermute, das 50 hz nur allzu schmale
Streifen erlauben und daher geringere Frequenzen besser aussehen (aber eben
andere Lampen/ Betrachter benötigen).
20.03.2022 Arduino Turntable Speed Wow and Flutter measuring Device
Lichtschranke an einen Digitalpin, Display dran, Zeit messen, fertich.
Dachte ich.
Aber es gab natürlich wieder ein paar
Detailschwierigekeiten. Hier ein paar Eckproblemchen: die richtigen
Variablen-Arten für den passenden Zweck (int, unsigned long, float)
bestimmen, alles natürlich ohne jede Delay-Anweisung hinbekommen, die
passende Art von Nachkommastellen darstellen und die Anzeigenbereiche immer
wieder frisch zu beschreibe, damit nicht alles nur noch weiß ist. Besonders
kniffelig: nur einmal bei einem Signal an der Lichtschranke eine Messung
vornehmen und nicht etwa zwei direkt nacheinander, weil die Unterbrechung
etwas länger als erwartet ist. Schließlich war das Hauptproblem dann aber,
dass die Millis-Zeitmessung mit dem Start des Arduino losgeht aber natürlich
nur die Runden korrekt gezählt werden dürfen, um eine aussagekräftige
Darstellung von Gesamtzeit nach z.B. 100 Runden (180 Sekunden/ drei Minuten) und
Durchschnitts-Umdrehungen pro Minute zu erhalten. Wenn z.B. der Arduino
angestellt wird, aber erst nach 20 Sekunden das erste Mal die Lichtschranke
unterbrochen wird, ist der Millis-Zeitzähler ja schon bei 20.000 und würde
dann das Ergebnis insgesamt verfälschen. Aber ich habe alles mit Flags
hinbekommen. Die erste Lichtschrankenunterbrechung setzt nun alles auf Null
und erst bei der zweiten wird die erste Runde berechnet. Vor dem Start ist
alles auch auf Null gesetzt außer der Rundenanzahl, die zur Erkennbarkeit
des Status mit einem "-" gekennzeichnet ist (das habe ich mit einer
While-Schleife gelöst).
Dann aber große Ernüchterung:
Während vor dem
PC, am USB-Port angeschlossen alle Test der Lichtschranke (ich habe ein
Stück Papier hindurchgeführt) gut verliefen, gab es beim Echtzeitbetrieb am
Plattenspieler Probleme mit der Zuverlässigkeit. Während die ersten fünf bis
zehn Runden gute Ergebnisse (mit ordentlich Gleichlaufschwankungen aber
konstanter Drehzahl über mehrere Runden) lieferten, kam es immer wieder zu
Aussetzern: der auf den Plattenteller geklebte Papierstreifen fuhr durch die
Lichtschranke aber es wurde kein Durchgang detektiert/ gezählt/ gemessen.
Ich habe den Papierstreifen breiter gemacht, um die Unterbrechungsdauer der
Lichtschranke zu erhöhen aber auch das führte zu keinem zuverlässigen
Betrieb. Wenn ich den Papierstreifen sehr schnell durch die Schranke schoss,
wurde nichts detektiert...ich konnte mir das aber auch nicht so recht erklären, denn eigentlich werden
solche Lichtschranken ja auch mit Scroll-Wheels benutzt
(Plastikscheiben mit vielen radialen Schlitzen, die auf einer Achse rotieren
und somit jeder Schlitz zu einem Signal/ zu einer Unterbrechung führt), die
viel schnellere Wechsel der Unterbrechung detektieren können müssen als eine
305 mm großer Plattenteller mir einem einzigen Papierstreifen darauf (mit
einer Geschwindigkeit von 528,137 mm/ s oder eben 1,901 km/h). Eine neue
Lichtschranke mit einem größeren Abstand zwischen den LEDs für einen
großflächigeren Bereich der Detektion brachte keine Verbesserung.
Lösung:
ich habe per seriellem Monitor mir die Millis-Zeitmarken nach jeder
Durchführung der recht kurzen Programmschleife angesehen: es vergingen
jedesmal mehr als 220 Millisekunden, als fast eine Viertelsekunde. Das führt
natürlich zu Aussetzern und Ungenauigkeiten der
Lichtschranken-Unterbrechungs-Detektion. Also flugs nachgesehen: das SSD1306
0,96 Zoll OLED Display mit der Adafruit_GFX.h und der
Adafruit_SSD1306.h Library ist recht langsam, wenn man zu häufig das Display
erneuert ( "display.display()") oder Zeichen neu schreibt. Also habe ich
alle unnötigen Refresh entfernt und alles Zeichen-Schreibbefehle in die
Detektions-Schleife gepackt, damit diese nur noch einmalig bei Bedarf (und
nicht wie bisher bei jedem Loop) ausgeführt werden. Somit konnte die
Ausführungsgeschwindigkeit auf unter 10 ms reduziert werden.
Tatsächlich ist sie noch schneller, da der serielle Monitor
("Serial.begin9600" im setup) samt Ausgabe der Werte (
"serial.println("Zeit")") die ganze Fuhre ja selbst schon gehörig ausbremst.
Ab jetzt wurde jede noch so schnelle Unterbrechung immer zuverlässig
detektiert, egal wie schnell ich den Papierstreifen durch die Lichtschranke
schoss. (kein Wunder bei mindestens 100 Detektionen pro Sekunde).
Den ganzen Code habe ich als txt-Dokument
hier gespeichert. (Lichtschrankensignal an D10 des Nano, Display SSD1306
SCL an A5, SDA an A4. (VCC und GND sind ja klar).
Jetzt nur noch ein
schickes Gehäuse und es kann noch öfter seinen Dienst erledigen:
links
oben werden gezählten Runden angezeigt, darunter die
durchschnittlichen Umdrehungen pro Minute (also die
Gesamtzeit geteilt durch alle Runden). Darunter die prozentuale
Abweichung vom Idealwert 33,333 rpm. Ein Plus-Zeichen habe ich
extra vorangestellt, damit es schick aussieht wie beim automatisch
vergebenen Minuszeichen bei Negativwerten. Rechts oben ist die
Gesamtzeit in Sekunden zu sehen (bequem abzulesen sind die
hoffentlich exakt 80 Sekunden bei den legendären 100 Runden), darunter die
letze Rundenzeit in Sekunden. Ganz unten ist in großer Schrift die
aktuelle rpm-Zahl zu sehen und darüber befinden sich mittig
und bündig drei senkrechte Striche, um die prozentuale
Abweichung zu visualisieren. Der mittlere Strich wandert von der Mitte nach
links bei Unterschreitung der Idealgeschwindigkeit und entsprechend
nach rechts. Die Skalierung habe ich extra großzügig und linear (und nicht
etwas invers logarithmisch) gewählt mit einer Absolutabweichung bis zum Rand
von zehn Prozent, damit nicht geringste Abweichungen (0,05& oder 0,001 rpm)
zu dramatisch erscheinen. Kann man ja ohnehin nicht hören, solche
Minimalschwankungen.
Apropos Schwankungen: es sind
jetzt keine mehr messbar. Genau wie die Stroboskopscheibe
(die ja wirklich sehr exakt ist mit 100 Signalen pro Sekunde) weist
jetzt auch die computergestützte Messung nur noch vernachlässigbare
Schwankungen auf (0,05% oder eben 0,001 rpm) und das sehr konstant. Die
bisher gemessenen Abweichungen lagen an der Software der Handys (für sehr
zeitkritische Anwendungen nimmt man ohnehin am besten Microcontroller, die
bit banging viel konstanter und präziser beherrschen als komplexe
Betriebssysteme, denen das Multitasking immer das Protokoll verpfuschen kann
in dieser Dimension; siehe WS2812 adressierbare LEDS mit ihren
Microsekundensignalen, die nur Toleranzen von Nanosekunden
akzeptieren... zur Erinnerung: Millisekunden sind Tausendstelsekunden,
Microsekunden Millionstel- und Nanosekunden sind Milliardstelsekunden.).
19.03.2022 Warum dreht das Strobe Wheel vom Transcriptor zu schnell?
Bevor ich mich der exakten, eigenen Messung der
Plattenspielergeschwindigkeit widme, zunächst die Erklärung, warum das
Stroboskop-Hütchen sich offensichtlich (alle bisherigen, unterschiedlichen
und voneinander unabhängigen Messungen belegen diese fehlerhafte Anzeige)
zu schnell dreht:
Das Strobe Wheel des Transcriptor Hydraulic Reference
wird von der Außenseite des Plattenspielerantriebriemens
angetrieben. Wenn nun der Riemen 1 mm dick sein sollte für eine korrekte
Funktion, bewirkt bereits eine geringe Abweichung der Dicke auf eine
dramatische Geschwindigkeitserhöhung des Stroboskoprades, denn das
Rad ist viel kleiner als der Plattenteller (nur etwa 57 mm im Durchmesser,
schwer hinreichend genau zu messen aufgrund der Rille für den Riemen) und
dreht sich über mit 171,428 Umdrehungen pro Minute viel schneller und ist
somit sehr viel empfindlicher für die Anzeige von Abweichungen (die 35
Striche auf dem Wheel müssen in exakt 0,35 s eine Drehung vollziehen, damit
die 50 hz passen). Da mir keiner der Anbieter mitteilen konnte, wie die
Spezifikationen des Originalen Antriebriemens lauten und ich die Dicke
ohnehin nicht ändern kann, muss ich also lediglich den Umfang des
Stroboskop-Rades erhöhen (0,2 mm sollten reichen), um eine korrekte Funktion
zu gewährleisten. Ich habe über dünne Papier- und Klebefolienstreifen
nachgedacht und bin schließlich bei einem gewöhnlichen Haushaltgummi
gelandet, das bei in einer Packung den frischen Schnittlauch
zusammengehalten hat (meine kleine Tochter liebt Rührei mit frischem
Schnittlauch). Das Gummi dehnt sich sehr dünn, sitzt fest auf dem Stroborad
und bietet erstklassige Traktion für den Plattenspielerriemen. Nach der
"Installation" das Ergebnis: die zuvor nach links (entgegen dem
Uhrzeigersinn) wandernden Striche stehen nun wie in Stein gemeißelt an der
gleichen Stelle (bei genau gemessenen 33,333 Umdrehungen pro Minute).
Perfektion. Herrlich.
Jetzt gilt es, nur noch um die
vermeintlichen Gleichlaufschwankungen zu klären.
18.03.2022 Transcriptor Hydraulic Reference Probleme und Lösungen
Die Stroboskopscheibe (Transcriptor strobe wheel) zeigte immer eine zu
schnelle Umdrehungszahl an: die Striche wanderten nach links. Ich benutzte
Silikonöl mit deutlich höherer Viskosität, das sich unter dem
Plattenteller in einer runden, mitrotierenden Schüssel befindet (silicone
fluid well) von 60.000 cps auf 100.000 cps aber der kleine Haken (speed
control vane), der in das Öl taucht, um eine bis zu vierprozentige
Geschwindigkeitskorrektur (speed control +/- 2% of nominal) zu bewirken,
wurde dann vom zu zähen Öl wieder nach oben gedrückt und das Öl floss nicht
mehr in seine Ursprungsform komplett zurück innerhalb einer Umdrehung.
Also probierte ich es mit moderateren 70.000 cps: immer noch wanderten die
Stroboskop-Strich nach links.
Ich entdeckte eine Handy-App (RPM Speed
and Wow), die die wesentliche Daten eines Plattenspielers exakt messen
können soll: rpm (Umdrehungen pro Minute), wow and flutter
(Gleichlaufstörungen und Gleichlaufschwankungen), Minimal- und
Höchstgeschwindigkeit, prozentuale Abweichung und eine Grafik der
Abweichungen.
Auf meinem Honor 6x ging das nicht zufriedenstellend, denn
das Gyroskop scheint volle Drehungen falsch zu interpretieren. Das alte
Okitel 10000 (das ich noch für die Sphero R2D2-Programmierung nutze) hat
laut App gar kein Gyroskop. Aber ich habe noch zwei identische, alte Sony
Xperia Style T3 Model D5103 und die zeigen leider auch stark voneinander
abweichende Werte an (33,23 zu 33,42 rpm mit einer konstanten Abweichung von
0,19 rpm. WOW war mit 0,41% identisch aber auch die minimalen und maximalen
Werten wichen stark voneinander ab selbst bei gleichzeitiger Messung). Ich
habe dann einfach mal 100 Umdrehungen per Hand gestoppt und siehe da: es sind
sehr, sehr genau 3 Minuten (33,333 Umdrehungen in 60 Sekunden bedeuten exakt
1,8 Sekunden für eine Umdrehung). Eine Stroboskop-Pappscheibe von Dynavox
(je 179 schwarze und weiße Striche wechseln sich ab, da 1.800 Blitze pro
Umdrehung bei 50 hz Wechselstrom stattfinden) zeigt mit alter
Glühwendel-Beleuchtung auch durch konstante Striche an, dass die
Geschwindigkeit extrem korrekt ist, während das Transcriptor Strobe Wheel des
Plattenspieler eine zu hohe Geschwindigkeit anzeigt. Ich habe nun noch eine
spezielle Stroboskop-Beleuchtung von One Little Bear (50/ 60 hz Turntable
Speed Test Lamp) hinzugezogen, da am Standort des Plattenspielers
mittlerweile LED-Leuchtmittel (die im Gegensatz zu Glühbirne und
Leuchtstofflampen ja gar keine vertauschte Polarisierung vertragen,
geschweigen den 50 mal pro Sekunde) dominieren. Die bei der Lampe
enthaltene, kleinere Stroboskopgeschwindigkeitsscheibe mit nur 100 mm
Durchmesser läuft identisch korrekt zur Scheibe- wie erwartet. Als nächstes
habe ich einen kleinen 3 x 6 mm Neodymmagneten mit einem Stück Uhu
Patafix Klebemasse an der Außenseite des Plattentellers befestigt um den
nach Edwin Hall benannten Hall-Effekt (das Phänomen des Auftretens einer
transversalen Potentialdifferenz, wenn ein Gleichstromleiter in ein
Magnetfeld gebracht wird) mittels des Magnetfeldsonsors im Handy zu
detektieren. Die App "Magnetic Counter" bietet einstellbare Barrieren, ab
deren Überschreitung ein Ereignis gezählt und in Umdrehungen pro Minute
umgerechnet wird. Aber auch mit dieser App kommt es ständig zu starken
Abweichungen der Rundenzeiten/ Umdrehungsgeschwindigkeiten. Ein
Laser-Drehzahlmessgerät DT-2234C+ kommt auch noch zum Einsatz, das aber nur
sehr wackelig zu handhaben ist. Auch hier gibt es Variationen der
Umdrehungsgeschwindigkeiten.
Ich habe also nunmehr stark unstete
Geschwindigkeiten angezeigt bekommen vom Laser-Messgerät, vom Hall-Sensor des
Handys und von der Gyroskop-App des Handys. Die 33,333 rpm sind jedoch
überwiegend erkennbar. Meine manuelle Messung über 100 Umdrehungen, die
kleine und auch die große Stroboskopscheibe zeigen jedoch, dass die
Geschwindigkeit korrekt ist.
Fazit: das kleine
Stroboskop-Hütchen, das sich auf dem Plattenspieler mitdreht,
zeigt die Geschwindigkeit falsch zu hoch an. Das ist ja schon mal ein
Ergebnis. (eine weitere Messmethode mittels einer Schallplatte mit einem
Referenzton und der Analyse dieses Tons mittels des Handymikrofons habe ich
nicht durchgeführt).
Nun habe ich mich der Gleichlaufschwankungen,
die von dem Handy per Gyroskop und Magnetsensor sowie vom Lasermessgerät
suggeriert werden. Plattenspielerriemen, Antriebsrollen und die Nut des
Plattentellers wurden gereinigt und mit ein wenig Talkumpuder behandelt. Die
Stroboskoplager und das Hauptlager ("ball -ended ground and polished steel
spindle running onto a hardened steel thrust pad and into PTFE bushes", also
mit einer kleinen Stahlkugel unter der Spitze) wurden gereinigt und neu
geölt. Kleine Reste übergelaufenen Silikonöls an der Unterseite des
Ölgefäßes und auf dem Boden wurden sorgfältig entfernt. Eine dünne
Papierunterlegscheibe wurde angefertigt und zwischen dem Ölgefäß und der
Plattentellerauflage angebracht ("To prevent damage to the fluid well and the
speed control vane a mating paper waher 'weak link' is fitted between the
platter mounting spindle and the fluid well". Die korrekte horizontale
Ausrichtung wurde mittels einer zusätzlichen Wasserwaage
(Plattenspielergewicht/ Stabilisator mit Wasserwaage, da die orignale
Wasserwaage/ Spirit Level ausgetrocknet ist) sichergestellt. Nichts davon
hat geholfen. Die Apps zeigen unstete Geschwindigkeiten. Wow and flutter zu
hoch.
Nun habe ich mir den Crouzet Synchronmotor genauer
angesehen: da steht zwar nur zusätzlich drauf "Brevete SGDG Made in
France L1C A10" aber 230 V und 50hz sind schon mal klar. Austauschmotoren
werden mit 600 rpm angegeben (wobei einige Ebayfraggles diese Info auf ihren
Angebotsfotos wegretouchieren...): Crouzet 22/79 direction CL voltage 240 50
hz type 82-330 600 r.p.m., also müssen auch 5 Polpaare (entsprechend 10
Pole, da (60*50hz)/5 Polpaare=600 rpm) vorhanden sein. Den Motor habe ich
geölt und einen Blick auf die wenigen Elektrobausteine geworfen, die aber
alle unauffällig aussahen und unkritisch sind (keine
Elektrolytkondensatoren, die auslaufen könnten, sondern
Keramikkondensatoren). Die Umdrehungsgeschwindigkeit habe ich mittels
Hall-Sensor-App und per Laser-Messer verifiziert: leichte Schwankungen aber
überwiegend glatte 600 U/pM sowohl im Betrieb mit installiertem Riemen als
auch mit nur sich drehender Achse ohne jede Belastung.
Nächstes
Fazit: Der Motor könnte leichte Schwankungen
aufweisen, aber da diese sowohl im Freilauf als auch unter
Belastung auftreten gemäß Laser-Messgerät und Handy-App erscheint mir das
nicht besonders palusibel, zumal der Motor legendär zuverlässig und sogut wie
nie der Grund für Probleme sein soll. Nun habe ich noch schnell die
Netzfrequenz geprüft:
hübsche 50 hz ohne jeden Tadel. Eine abweichende Netzfrequenz verändert ja
direkt die Laufgeschwindigkeit von Synchronmotoren und
diesen Effekt haben wir ja schon mal erlebt im Jahr 2018. Daran kann es
also auch nicht liegen. Daher habe ich auch die Idee von speziell
"stabilisierten" Netzteilen für Plattenspieler verworfen und auch Netzteile,
die die Wechselfrequenz aktiv ändern, um die Geschwindigkeit des Motors von
33 auf 45 direkt ändern, gefallen mir gar nicht. Weiter geht es also mit der
ultimativen Wissenschaft: eigene Messungen vornehmen.
23.02.2020 Videoclip zum Konzert im Kulturpalast Dresden
Mit einem Selfie mit Nina Eichinger am Ende. :-)
12.01.2020 Dresdner Kulturpalast Sound of John Williams and Hans Zimmer
Nina Eichinger, das Pilsen Philharmonic Orchestra und Christian Schumann.





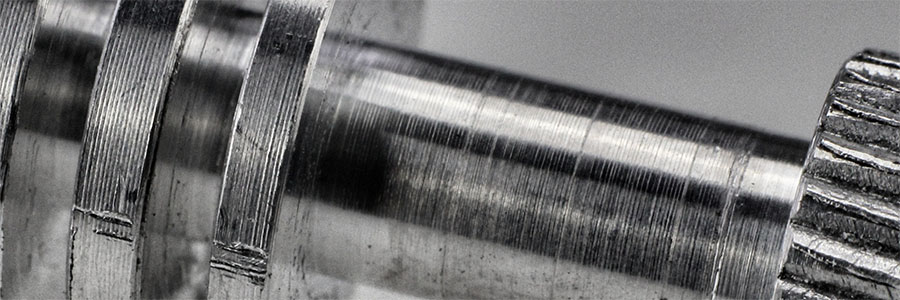
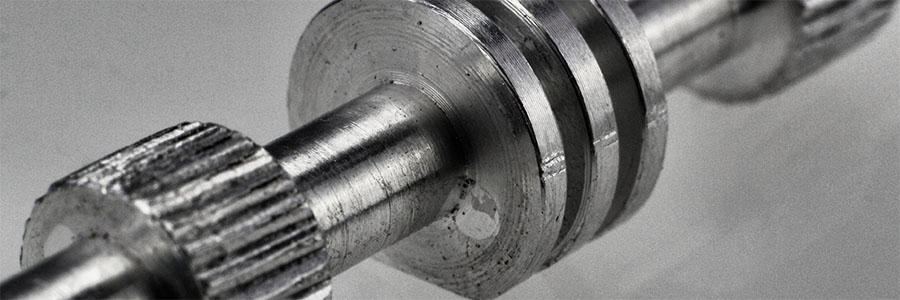
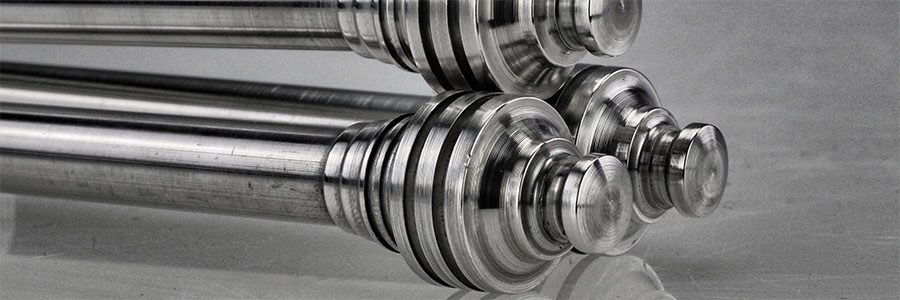




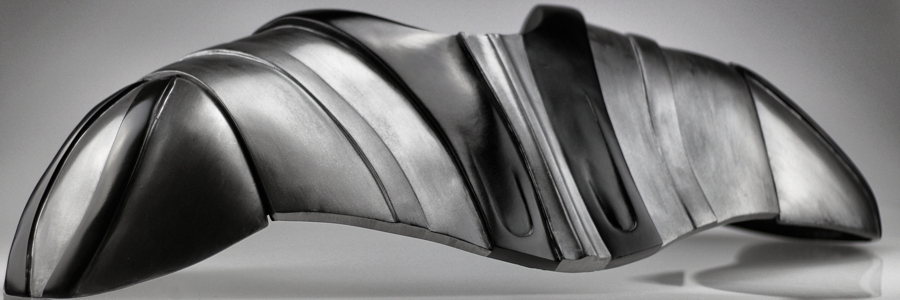

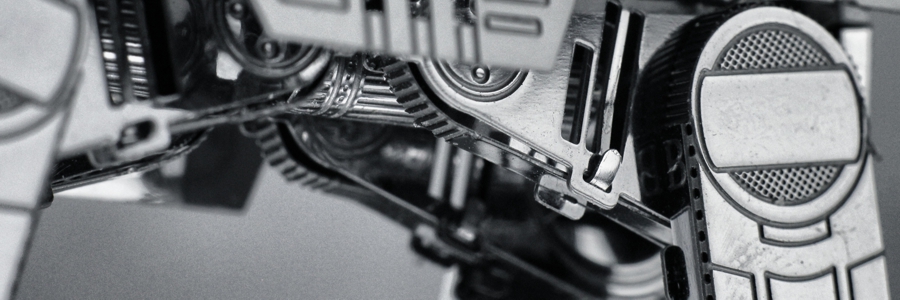



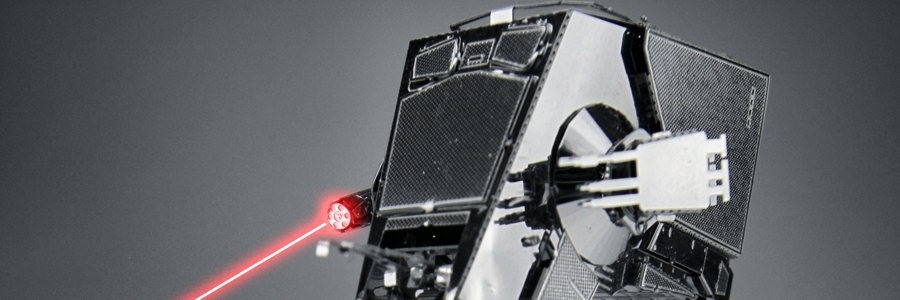







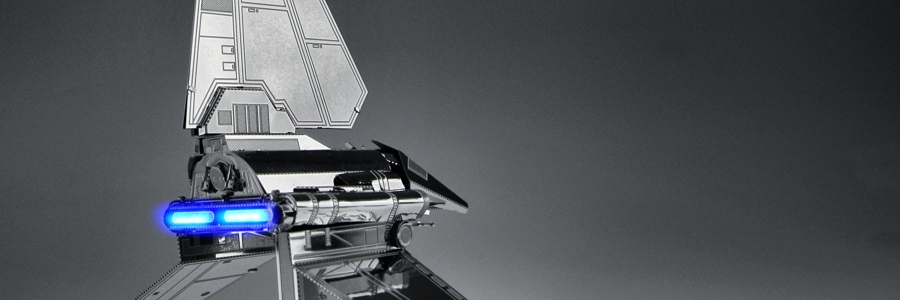
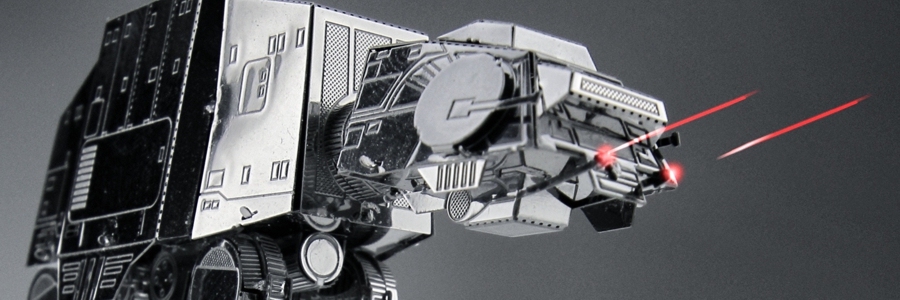
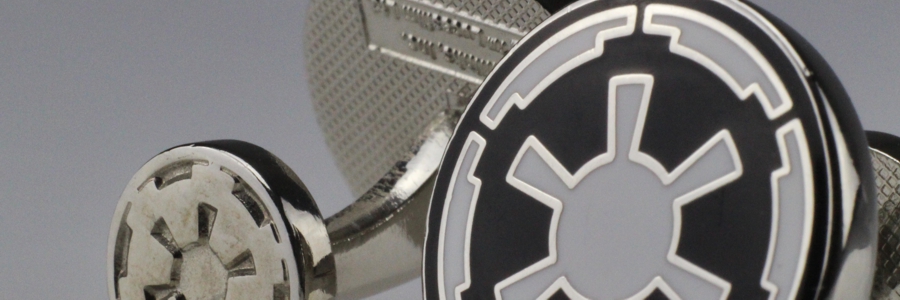


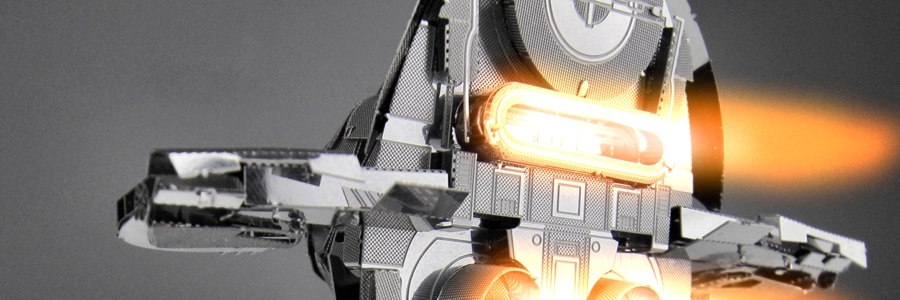

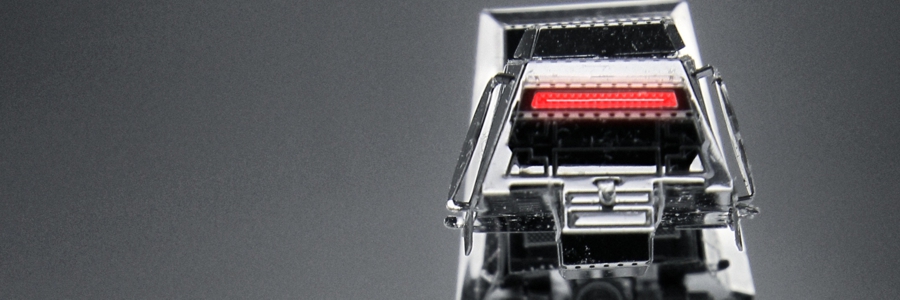

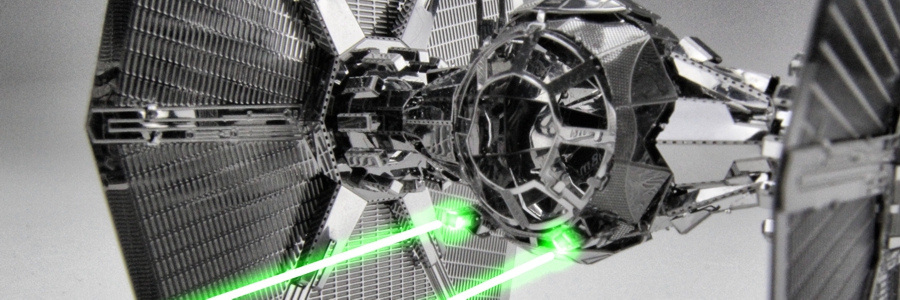

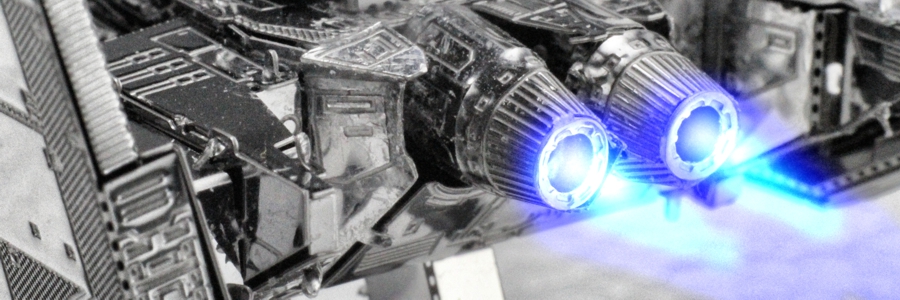



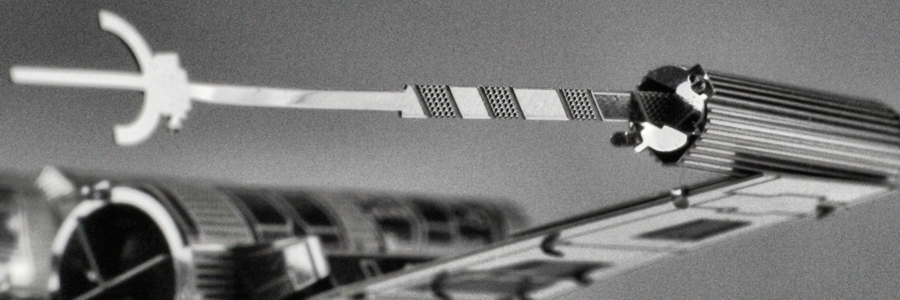
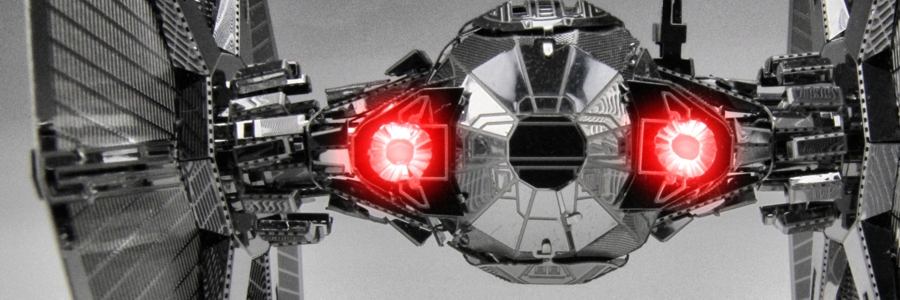



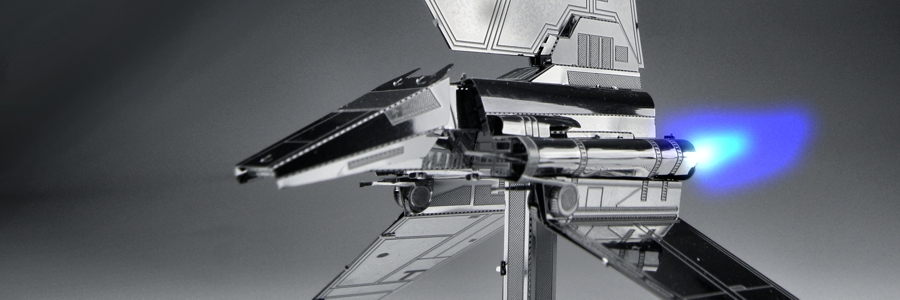










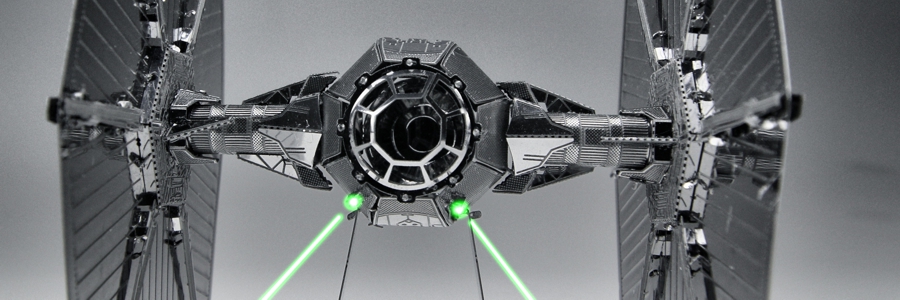

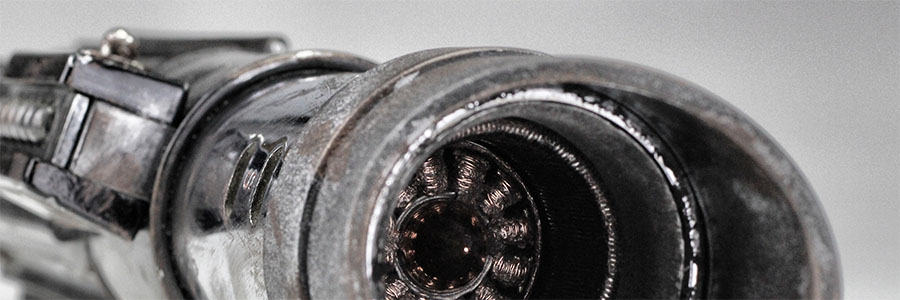

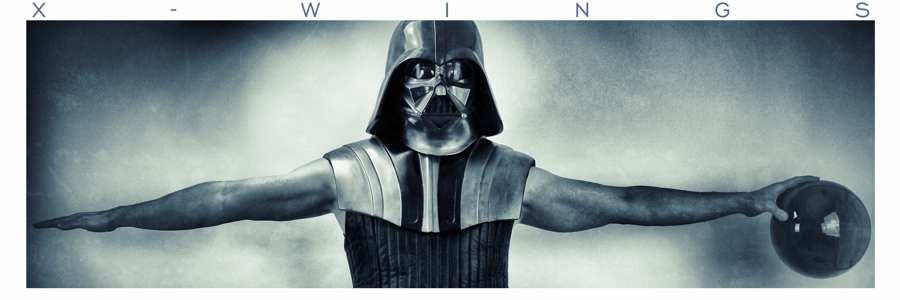
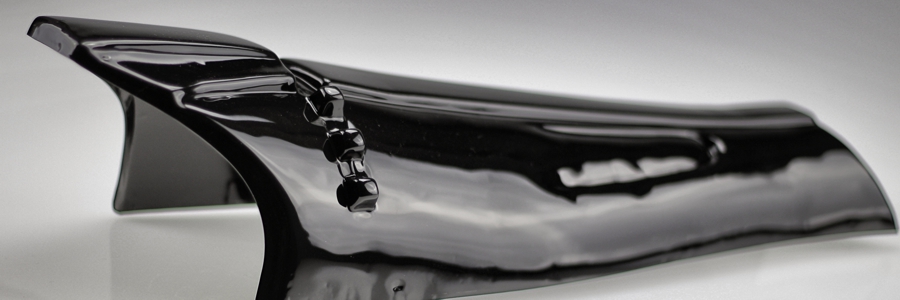

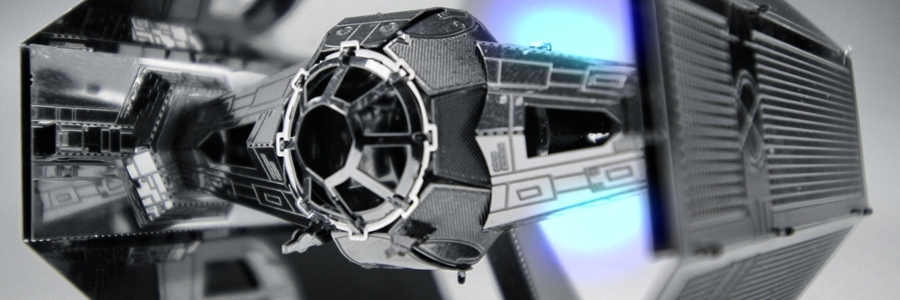

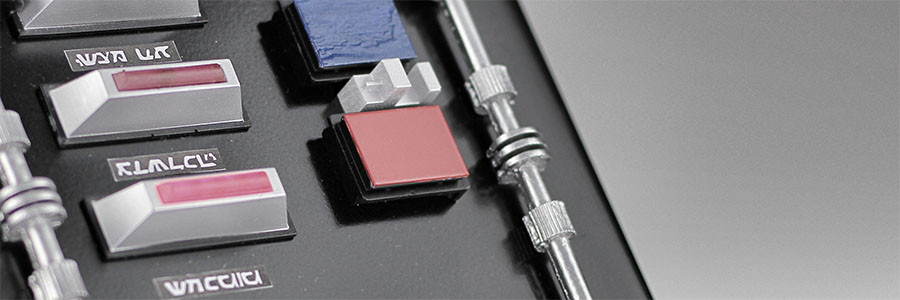

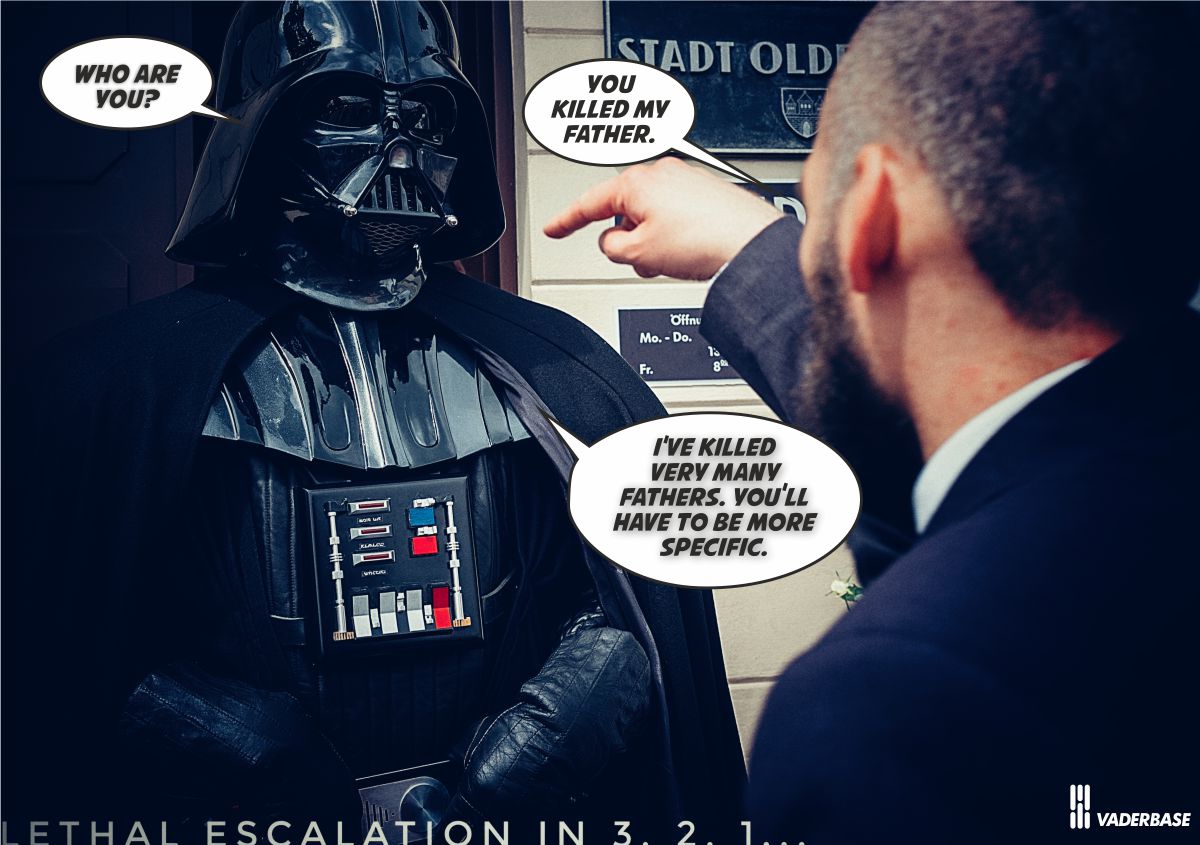
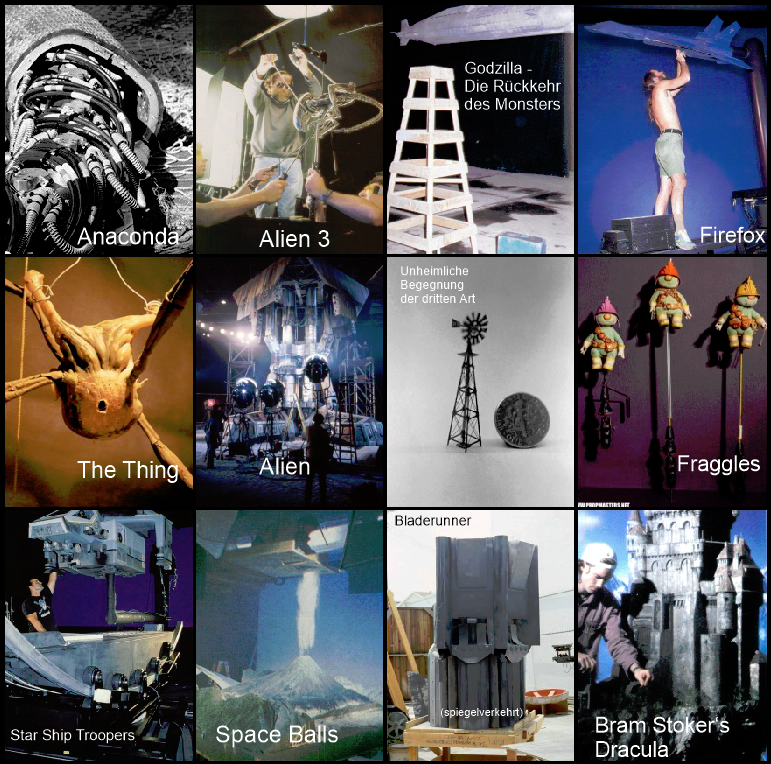
Komme Auf Die
Dunkle Seite Der Macht!